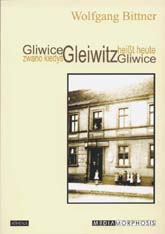In einem Barackenlager aufgewachsen, begann sich Wolfgang Bittner in den 70er Jahren mit seiner schlesischen Vergangenheit auseinander zu setzen. Noch während des Zweiten Weltkriegs in Gleiwitz/Oberschlesien geboren, erlebte er als Kind die Schrecken des Kriegsendes und der Vertreibung, wie auch den Neubeginn im angeblich goldenen Westen, der für viele Flüchtlinge und Heimatvertriebene lange Jahre überhaupt nicht golden war. In Essays, Geschichten und Bildern führt der Autor dem Leser diese Epoche deutsch-polnischer Geschichte vor Augen, und zwar am Beispiel einer Familie, die in Schlesien zu Hause war und durch den Zweiten Weltkrieg entwurzelt wurde. Keine Lebenserinnerungen oder Heimatliteratur, sondern ein literarisch-gesellschaftspolitisches Zeitdokument, die Bearbeitung eines Traumas.
Medienresonanz
„Manche Bücher wirken unspektakulär, ihre Bedeutung erweist sich auf den zweiten Blick … bemerkenswert die Haltung, mit der Wolfgang Bittner erzählt: frei von Ressentiments oder revanchistischen Anwandlungen…“ (Ossietzky)
„Die Erinnerungen sind erstaunlich vielfältig und genau … und Wolfgang Bittner berichtet auch von seinen Erfahrungen im heutigen Gleiwitz.“ (Westdeutscher Rundfunk)
„Bittner beschönigt nichts … dass es unüberbrückbare soziale Unterschiede zwischen den Heimatvertriebenen und den Einheimischen gab.“ (Ostfriesen-Zeitung)
„Das geht unter die Haut … Ein literarisch-essayistisches Werk, informativ und brisant … die Bearbeitung des Traumas einer ganzen Generation, das bis heute nachwirkt.“ (Neues Deutschland)
„Der Autor macht in seinem Vorwort wie auch in mehreren anderen Beiträgen deutlich, dass er Schlesien keineswegs ‚heim ins Reich’ holen will, wenn er den geschichtlichen Hintergrund erhellt und von der deutschen Vergangenheit berichtet. In Polen gilt er als ‚entschiedener Verfechter des deutsch-polnischen Dialogs’ und ‚Fürsprecher der Verständigung’ zwischen beiden Völkern…“ (DOD)
„Bittner versteht Schlesien und seine heutigen Probleme. Er recherchiert in Archiven, kommt mit Schlesiern selbst ins Gespräch … Daraus entsteht ein Bild über die Zeitgeschichte, ein privates ‚familiäres Europa’… Der Schriftsteller schreibt mit erstaunlicher Offenheit und journalistischem Können.“ (Tygodnik Powszechny, Warschau)
Leseprobe
Mich erfasste eine eigenartige Stimmung, eine Mischung aus Freude und Traurigkeit, aus Euphorie und Melancholie, diese Mollstimmung, die ich oft festgestellt habe, wenn ich in Schlesien war, nicht nur bei mir. Und ich merkte jedes Mal, dass ich emotional beteiligt war, obwohl ich mich für abgeklärt hielt. Lange Zeit habe ich gedacht, Heimat sei da, wo man in Frieden leben könne, seine Freunde habe, sein Auskommen und ein Dach über dem Kopf. Der Begriff „Heimat“ erschien mir ohnehin abgenutzt, missbraucht, und war mir insofern suspekt. Aber je älter ich werde, desto überzeugter bin ich davon, dass es noch eine andere Wahrheit gibt, Verbindungen, die weiter reichen als Gedanken, und Verletzungen, die bei mir tiefe Narben hinterlassen haben … Vielleicht hat ja der Mensch auch so ein inneres Koordinatensystem ähnlich den Lachsen oder den Schwalben, die über Tausende von Kilometern an den Ort ihrer Geburt zurückfinden.
Sicher, wir leben heute in einer so genannten mobilen Gesellschaft. Immer weniger Menschen bleiben ihr Leben lang dort ansässig, wo sie geboren wurden. Aber es ist ein gravierender Unterschied, ob jemand seine Heimat freiwillig verlässt, vielleicht um woanders zu arbeiten, oder ob er unter unmenschlichen Bedingungen vertrieben wird und nicht mehr zurückkehren darf. 1941, also während des Zweiten Weltkriegs geboren, setzen meine frühesten Erinnerungen 1944/45 ein …